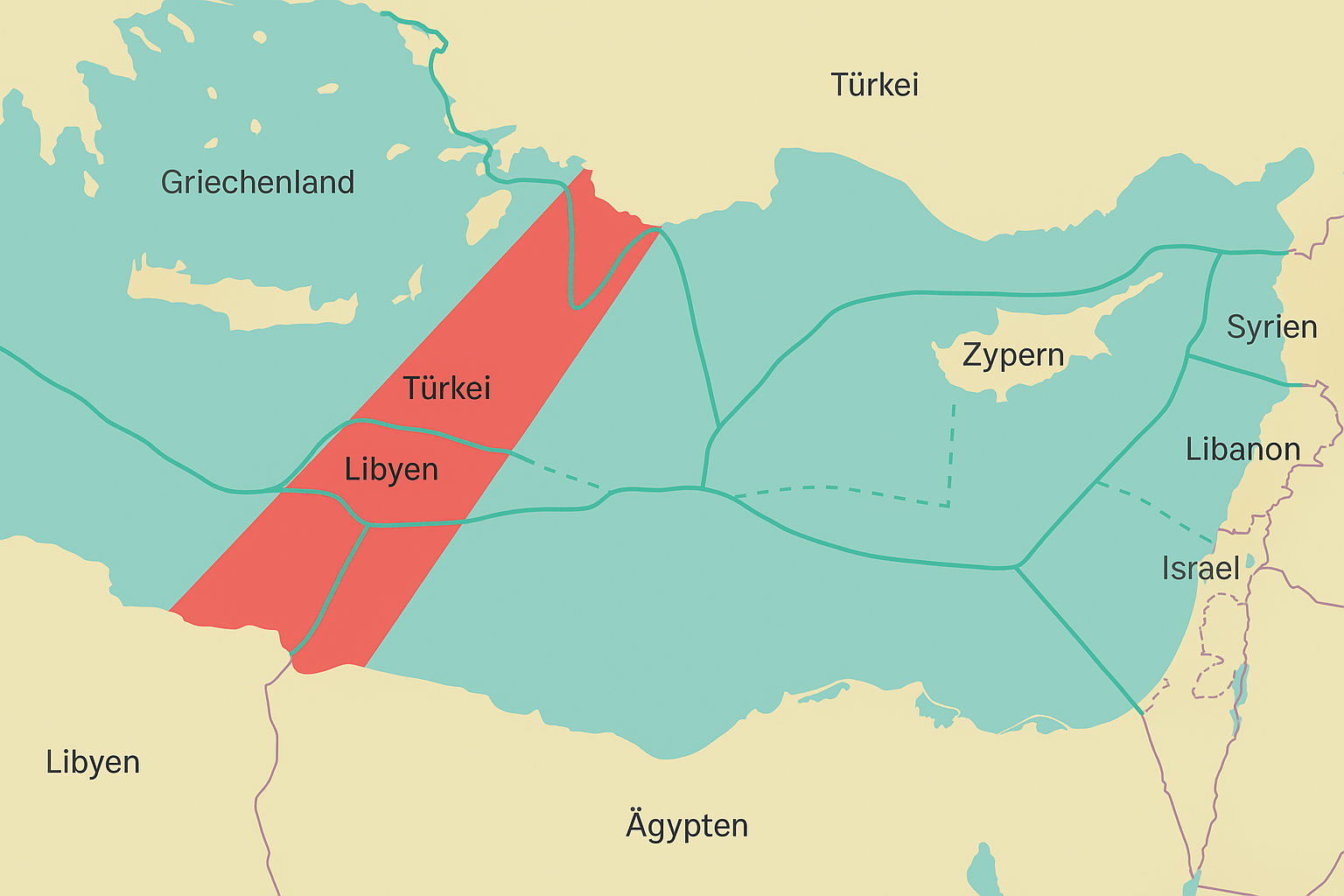Nach Jahrzehnten im Exil in Großbritannien schildert Rafael Luzon, Vorsitzender des Verbands der Juden Libyens, seine persönliche Geschichte: von seiner Kindheit in Bengasi über geheime Gespräche mit dem Gaddafi-Regime bis hin zu seiner Entführung nach der Revolution. Ein Interview, das von lebendiger Erinnerung, ungebrochener Sehnsucht und einer offenen Frage geprägt ist: Gibt es eine Zukunft für Juden in Libyen?
Herr Luzon, wie würden Sie Ihre Verbindung zu Libyen trotz der langen Zeit der Vertreibung und Abwesenheit beschreiben?
Meine Beziehung zu Libyen ist nach wie vor intakt – mit einigen Persönlichkeiten sogar ausgezeichnet. Natürlich gibt es immer wieder sogenannte “Tastaturhelden”, die nicht zögern, Beleidigungen oder Drohungen auszusprechen. Aber solche Stimmen ignoriere ich völlig.
Was sind Ihre prägendsten Kindheitserinnerungen an Bengasi?
Ich erinnere mich an ein gesellschaftlich und kulturell vielfältiges Umfeld: Araber, Briten, Malteser, Juden und Griechen lebten miteinander wie eine große Familie. Unsere wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen waren eng miteinander verwoben.
Gleichzeitig waren wir aber systematisch benachteiligt. Juden durften keine öffentlichen Ämter übernehmen, nicht in die Armee oder Polizei eintreten. Selbst zur Eröffnung eines Geschäfts brauchte man einen arabischen Partner. In politisch aufgeheizten Zeiten, insbesondere durch Anhänger Nassers, kam es regelmäßig zu antijüdischen Demonstrationen.
Wie kam es zu Ihrer ersten Begegnung mit Gaddafi, und was geschah dabei?
Ich hatte einen Artikel verfasst, in dem ich erwähnte, dass meine Mutter sich wünschte, Libyen vor ihrem Tod noch einmal zu sehen. Dieser Text gelangte zu Gaddafi – er lud uns ein, meine Mutter und mich, 42 Jahre nach unserer Vertreibung. Während des Besuchs traf ich den damaligen Sicherheitsminister Bouzid Dorda und den Minister für internationale Organisationen, Suleiman al-Shahoumi. Gemeinsam entwickelten wir mehrere Absprachen in Bezug auf das jüdische Erbe in Libyen.
Worum ging es in diesen Vereinbarungen, und wurden sie jemals umgesetzt?
Ich schlug vor, eine Gedenktafel an den Orten der zerstörten jüdischen Friedhöfe anzubringen – das wurde zugesagt. Ich bat um die Restaurierung einer Synagoge als Zeichen der Versöhnung – auch das fand Zustimmung. Die Anerkennung der Opfer des Pogroms von 1967 brachte ich zur Sprache – man zeigte sich offen für einen Dialog. Auch das Thema der Gleichbehandlung jüdischer Libyer kam auf den Tisch, worauf man mich an die zuständigen Stellen verwies.
Doch mit dem Ausbruch der Revolution am 17. Februar kam alles zum Stillstand. Trotzdem pflegte ich weiterhin diskrete Kontakte zu libyschen Entscheidungsträgern. So konnte ich später einen libyschen Minister zu einer Gedenkveranstaltung auf Rhodos einladen, 50 Jahre nach der Vertreibung. Auch organisierte ich Treffen mit israelischen Ministern libyscher Herkunft.
Hatten Sie den Eindruck, dass das damalige Regime ehrlich an einem Neuanfang interessiert war?
Ja, ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass sie es ernst meinten. Man versprach mir sogar, meinen libyschen Pass zu erneuern und die Opfer von 1967 offiziell anzuerkennen.
Wie reagierte Gaddafi auf das Thema der jüdischen Vertreibung?
Er behauptete, die Vertreibungen hätten unter König Idris stattgefunden, nicht unter seiner Herrschaft. Ich entgegnete ihm, dass seine Maßnahmen noch gravierender gewesen seien: Er habe nicht nur die Friedhöfe zerstört, sondern auch das kollektive Gedächtnis einer jahrtausendealten jüdischen Präsenz ausgelöscht.
Nach seinem Sturz kehrte ich nach Libyen zurück – wurde jedoch von einer islamistischen Miliz für acht Tage entführt! Nach den Verhören entließen sie mich mit den Worten: „Du bist weiß wie Schnee – ein großartiger Libyer!“
Wie bewerten Sie die derzeitige Lage in Libyen?
Die Situation ist äußerst komplex: zwei Regierungen, zwei Machtzentren, gespaltene Städte wie Tripolis, Bengasi oder Misrata. Die Sicherheitslage bleibt instabil, und die Korruption ist tief verwurzelt. Trotz der Bemühungen der Vereinten Nationen und amerikanischer Vermittler werden Wahlen und politische Einigungen immer wieder verschoben.
Gibt es Hoffnung auf eine Rückkehr jüdischer Libyer?
Nach fast sechs Jahrzehnten Exil denkt kaum jemand an eine dauerhafte Rückkehr. Doch viele – insbesondere aus der jungen Generation – hegen den Wunsch, Libyen zu besuchen. Einige könnten als Gäste oder Investoren zurückkehren, nicht mehr.
Wie bewahrt die jüdisch-libysche Gemeinschaft ihr kulturelles Erbe?
Wir pflegen weiterhin unsere Traditionen – in der Küche, bei Hochzeiten, in der Musik und der Sprache. Selbst die libysche Denkweise lebt in uns weiter.
Sind Sie der libyschen Musik noch immer verbunden?
Ja, ich höre mit Freude klassische Lieder wie den Merskawi, Songs von Ali Shaalija und Fongia. Auch einige neue Künstler verfolge ich interessiert.
Was wäre Ihrer Meinung nach ein Weg aus der Krise?
Die Lösung kann nicht von außen kommen. Libyen braucht jemanden, der die Mentalität, Sprache und Kultur der Menschen wirklich kennt – jemand Unabhängigen, ohne parteipolitische Agenda. Vielleicht ist das sogar ein libyscher Jude.
Welche Botschaft möchten Sie den Libyern mitgeben?
Trennt zwischen Religion und Staatsbürgerschaft. Hasst uns nicht, weil wir Juden sind. Libysche Juden haben diesem Land nie geschadet – im Gegenteil. Mein Großvater aus Misrata kämpfte an der Seite von Ramadan al-Suwayhli gegen den Faschismus. Vertraut uns – wir könnten eine konstruktive Kraft für Libyens Zukunft sein.
Interviewt von: Abderrahmane Ammar